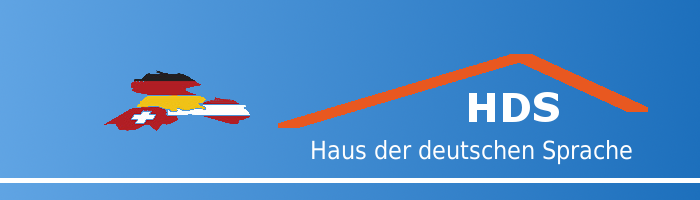Dingens, na, wie heißt es denn?
Von Christina Wittich
Was ist eigentlich ein Näkubi? Und was ein Philtrum? Manche Dinge haben gar keinen Namen. Oder kaum einer kennt ihn.
Eines Tages war das Klo verstopft. In Abwägung Öko contra Chemie gewann das gute Gewissen, und mit des tapferen Heimklempners glänzendem Schwert, … also, ähm, diesem, äh, hier, Dingens … Na das halt: Langer Stiel aus Holz, rote Gummikappe, wird, wenn sauber, gern auch als lustig gemeinte Kopfbedeckung missbraucht. Der Pömpel? Findet sich nicht im Duden, könnte aber sein. Der eher zarte „Gummisauger“ und der brachiale „Saugstampfer“ stünden ebenfalls zur Wahl – sind aber leider ebenso wenig mit einer Eintragung im großen Buch der Wörter bedacht. Gibt es überhaupt, was im Duden nicht benannt wird? Offensichtlich. Das Ding im Bad hat keinen Namen und dennoch steht es im Raum und verrichtet zuverlässig und stumm seine Dienste. Wer es rufen möchte, verirrt sich jedoch ebenso hilflos im Wald der Beschreibungen wie anno dazumal Edmund Stoiber bei seinem Versuch, eine Fahrt mit dem Transrapid in Worte zu fassen.
Dinge ohne Namen bevölkern die Warenwelt. Versehen mit einer Bezeichnung noch während des Herstellungsprozesses, ist ihnen der Name auf dem Weg in die Hände des Nutzers verloren gegangen. Oder es hat sich nie jemand die Mühe gemacht, einen zu finden. Für den Kleiderhaken aus Plastik im Umkleideschrank des Schwimmbades zum Beispiel, an dem noch ein Netz und ein nach unten verlängerter Haken angebracht sind. Das Netz, so munkeln Badbesucher, sei zur Unterbringung von Unterwäsche und Socken gedacht, gestehen aber, es noch nie auf diese Weise verwendet zu haben. Wenn überhaupt.
Der Klassiker im Supermarkt
Oder, immer noch im Schwimmbad, dieses ganze therapeutische Wasserspielzeug: Schwimmhilfen, die aussehen wie Eisschollen oder sehr große bunte Wattwürmer. Sind da, machen Spaß, aber wenn man sich ihrer bedienen möchte, sollte man sie selbst holen, weil die Umschreibung zu viel Zeit in Anspruch nähme. In der Werkstatt ist es ein Stachel mit Griff, im Büro der Greifer, mit dem sich Heftklammern entfernen lassen – die sind zwar kleiner, tragen aber einen Namen. Womöglich, weil sie in der Überzahl sind. Wie heißen diese wassergefüllten Plastikkugeln im Gefrierfach und wie der Behälter, in dem Wasser zu Eiswürfeln gefroren wird? Der Klassiker ist natürlich das schmale Teil auf dem Warenband zur Supermarktkasse, mit dem der eine Kunde seinen Einkauf von dem des nächsten fernhält.
Selbst Dresdner Verkäuferinnen wissen laut einer kurzen, nicht repräsentativen Umfrage nicht, womit sie dort jeden Tag hantieren. „Das haben Kunden schon so oft gefragt“, sagt eine und zuckt ratlos mit den Schultern. „Warentrenner nennt man das!“, ruft ein kahler Mann vom hinteren Ende des Warenbandes. Er klingt genervt, womöglich möchte er zahlen. Hätte er mehr Geduld gehabt, hätte der Mann noch erfahren, dass zudem die Bezeichnungen Warentrennholz, Trenner, Separator, Holz, Reklameriegel, Kassentoblerone und Näkubi (für „Nächster Kunde bitte“) kursieren.
Dass sich keiner der Begriffe bisher wirklich durchgesetzt hat, ist eine Frage der Sprachökonomie: Der Mensch benennt, was ihm zu benennen wichtig erscheint, weil er ständig darüber reden muss. Für alles andere spart er sich den Aufwand. „Wir benutzen viele Dinge fast jeden Tag, haben aber selten die Gelegenheit, uns darüber auszutauschen“, sagt der Sprachwissenschaftler Reinhard Fiehler vom Institut für Deutsche Sprache in Mannheim. Fiehler nennt semantische Lücke, was nicht nur auf Alltagsgegenstände zu übertragen ist, sondern auch auf weniger Greifbares.
Zum Beispiel auf Generationen. „Es gibt die Jugend und es gibt das Alter. Aber wie heißt die Generation dazwischen?“, fragt er. Eine Zeit lang habe er überlegt, dass er die nicht alten und nicht jungen kurz „Erwachsene“ nennen könnte, hat sich inzwischen aber dazu entschlossen, sie schlicht „Mittlere Generation“ zu nennen – eine Generation, die sich speist aus der „Generation Praktikum“ und sich aufteilt in die Twenty-Somethings, Best Ager oder Babyboomer. „Für den Regelfall gibt es keinen prägnanten Begriff“, sagt der Wissenschaftler, „häufiger benennen wir die Abweichung“.
Nicht einmal vor dem eigenen Körper macht der Mensch dabei Halt.
Fünf Zehen hat er im Normalfall pro Fuß, davon kennt er den großen und den kleinen Zeh – aber wie heißen die übrigen drei dazwischen? Der Mediziner wird es wissen. Der Laie braucht keinen Namen, so lange er gut laufen und bei Schmerzen immer noch zeigen und zählen kann. Die Kerbe zwischen Lippe und Nase, die Rinne, deren Funktion gerade bei Kleinkindern sehr anschaulich zutage tritt, heißt fachlich korrekt Philtrum. Aber das sagt doch keiner: „Komm, wisch dir mal den Popel vom Philtrum.“ Einen anderen Namen dafür gibt es aber nicht.
Und was ist das Gegenteil von durstig, das Äquivalent zu satt? Betrunken. Sehr witzig.
Jedoch, zu viel Alkoholfreies kann man, so suggeriert es die Sprache, offenbar nicht zu sich nehmen. Ein großer deutscher Eistee-Hersteller wollte diese sprachliche Lücke füllen und hat vor zwölf Jahren in Zusammenarbeit mit dem Duden nach einem passenden Adjektiv gesucht. Mehr als 100.000 Teilnehmer hatten im letzten Jahr des alten Jahrtausends ihre Vorschläge an die Fachjury geschickt. Darunter waren „nimedu“ für „nicht mehr durstig“ oder „dulo“ für „durstlos“, außerdem „gewässert“, „gelöscht“ und „abgefüllt“.
Am Ende überzeugte „sitt“. Zumindest die Duden-Redaktion: „Es ist leicht sprechbar und bildet außerdem mit seinem Kollegen satt einen Stabreim“, begründete damals der Leiter der Duden-Redaktion die Wahl. Das lateinische „sitim sidare“ bedeute zudem „den Durst löschen“. Sitt war trotz seiner intellektuellen Wurzeln ein Rohrkrepierer, ist kein Kind des neuen Millenniums geworden. „Ich bin jetzt aber sitt und satt“, wird 2011 niemand sagen, nachdem er bei Tisch darüber diskutierte, welchen Namen man den ersten zehn Jahren des neuen Jahrtausends geben kann, oder den folgenden zehn. Oder darüber, wie man das Geräusch nennt, das der Wind macht, wenn er durch die Blätter der Birke fährt, oder wie der Anblick heißt, wenn Sonnenstrahlen wie Suchscheinwerfer durch dichte Wolken scheinen. Niemand, nicht einmal mehr der Duden, verwendet „sitt“, weil das Wort unnatürlich war, aufgepfropft wie ein Tannenzweig auf einen Obstbaum. Ein Werbegag auf Kosten der Sprache.
Zu viel ist einfach nur da
„Sprachen sind nicht perfekt“, sagt Reinhard Fiehler. „Sie weisen wie alles natürliche Mängel auf.“ Der Deutsche behilft sich, indem er umschreibend komponiert: Kettenkugelimpulsmobiledingsbums. Er macht Markennamen zu Produktbezeichnungen, sagt Tempo zum Papiertaschentuch, Tesa zum Klebestreifen und googelt, wenn er im Internet eine Suchmaschine bedient. Er verfällt in Mundartliches und sagt zum Beispiel Apfelgriebsch oder Hitsche.
Am Anfang war das Ding, nicht das Wort. Und wer die Dinge beherrschen wollte, gab ihnen Namen. Inzwischen aber hat sich die Lebens- und Berufswelt und mit ihr die Sprache so sehr differenziert, dass nicht mehr jeder jeden Begriff kennen kann. Die Produktion von Gütern hat außerdem ganz nebenher den Erfindungsreichtum der Menschen eingeholt. Was verschwindet, nimmt seinen Namen mit, wird ersetzt, ergänzt, verbessert, erweitert. Es gibt zu viel und zu viel davon ist einfach nur da und fällt nicht auf, weil es Hilfsdienste verrichtet. Erst, wenn die Schnürsenkel aufdröseln, weil ihnen die Befestigung an beiden Enden fehlt, wenn CDs aus ihren Hüllen fallen, weil es den Zackenkranz in der Mitte nicht gibt, wenn der Schreibtisch unter Konfetti versinkt, weil der Plastik-Aufsatz am Fuße des Lochers nicht vorhanden ist, wenn Geschenke öde verpackt aussehen, weil das kleine Gerät, mit dem man Geschenkebändchen so schön in schmale Streifen schneiden kann, weg ist, dann erinnert man sich und dann heißt es auf einmal wieder: Bring mir doch mal das …, du weißt schon. Na, hier – Dingens!
Der Artikel ist erstmals erschienen im
Magazin der Sächsischen Zeitung vom 21. Mai 2011.
aus VDS-Sprachnachrichten Nr. 51, September 2011