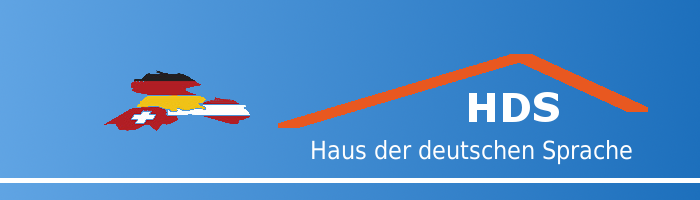Die indogermanische Sprachfamilie und die Rekonstruktion ihrer Ursprache
Bekanntlich steht die deutsche Sprache nicht allein, sondern ist ein Mitglied einer großen Familie. Ihre näheren Verwandten sind die germanischen Idiome wie Niederländisch, Englisch, Dänisch oder Schwedisch. Zur ferneren Verwandtschaft gehören fast alle europäischen, iranischen und die meisten nordindischen Sprachen. Diese große „indogermanische“ Sprachfamilie reicht geographisch von Island bis Indien und umfasst heute über 220 Sprachen. Die Ursprache dieser Familie, aus der sich im Laufe der Jahrtausende alle indogermanischen Sprachen entwickelt haben, wurde vor mehr als 5000 Jahren wahrscheinlich in den weiten Steppengebieten nördlich des Schwarzen und Kaspischen Meeres gesprochen. In diesem Artikel geht es um die Frage: Wie kann man die Laute, Wörter und Formen der Ursprache rekonstruieren, von der kein einziges Wort schriftlich überliefert ist? Von Ernst Kausen
Am 2. Februar 1786 hielt der äußerst sprachkundige britische Kolonialjurist William Jones eine berühmt gewordene Rede vor der Royal Asiatic Society in Kalkutta. Es ging um die altindische Sanskrit-Sprache und ihre Beziehungen zu europäischen Sprachen wie Lateinisch, Griechisch oder Gotisch.
Der Kern von Jones Aussage: Das Altindische weist mit diesen europäischen Sprachen mehr Gemeinsamkeiten im Wortschatz und in den grammatischen Formen auf, als durch Zufall oder wechselseitigen Austausch zu erklären wären. Zum Beispiel heißt „Vater“ lateinisch pater, gotisch fadar, griechisch patḗr und altindisch pitár. Ein anderes Beispiel: lateinisch fer-s, gotisch baira-s, griechisch phérei-s und Sanskrit bhára-si „du trägst“. Hier stimmen nicht nur die Wortstämme weitgehend überein, sondern auch die grammatische Endung -s ist als Kennzeichen der 2. Person Singular in allen Sprachen gleich. Hunderte solcher Wortgleichungen hatte Jones zusammengestellt und auch in den Beugungsformen der Substantive und Verben viele Parallelen gefunden.
Wie waren diese systematischen Übereinstimmungen zu erklären? Jones’ Antwort, die uns heute fast selbstverständlich erscheint, war damals aufsehenerregend: Alle diese Sprachen müssen von einer gemeinsamen Urmutter oder Ursprache abstammen, in Jones’ berühmten Worten: „they sprung from some common source“ („sie entsprangen einer gemeinsamen Quelle“). Diese Idee setzte sich durch und führte im 19. Jahrhundert zu einer der bedeutendsten Leistungen der Geisteswissenschaften, nämlich dem Aufbau der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft. Hatte man zunächst das Sanskrit selbst im Verdacht, die Urmutter der untersuchten Sprachen zu sein, stellte sich bald heraus, dass auch Sanskrit nur ein Kind derselben Familie war. Man konnte also die Ursprache nicht konkret greifen, sie war ein gedankliches Konstrukt, von dem keinerlei schriftliche Aufzeichnungen existierten.
Zu der großen Sprachfamilie, deren Umfang nun immer deutlicher wurde, gehörten offensichtlich die germanischen und romanischen Sprachen – letztere ihrerseits die Töchter der Mutter Latein –, aber auch die keltischen, slawischen, baltischen, iranischen und ein großer Teil der indischen Sprachen. Die Familie bekam auch bald einen Namen. Ein dänischer Geograph nannte sie „indogermanisch“, weil die germanischen Sprachen die äußerste westliche Ausdehnung (in Island) und die indischen Sprachen den östlichsten Punkt ihrer Verbreitung markierten. Nahezu gleichzeitig kam die Bezeichnung „indoeuropäisch“ auf, hinter der dieselbe Motivation steckt. Heute umfasst die indogermanische Sprachfamilie etwa 220 Mitglieder mit mehr als drei Milliarden Sprechern. Außerdem sind über 80 ausgestorbene indogermanische Sprachen bekannt – z.B. Latein, Altgriechisch, Sanskrit oder Hethitisch –, von denen nur eine mehr oder weniger umfangreiche schriftliche Überlieferung zeugt.
Eine interessante Frage war, woher alle diese Sprachen letztlich stammen. Wann und auf welchen Wegen sind sie in die Gebiete gelangt, wo sie später nachgewiesen wurden oder wo man sie heute vorfindet? Es geht also um die ursprüngliche Heimat der hypothetischen Familienmutter, man spricht von der „Urheimat“ (übrigens auch im Englischen). Die Urheimatfrage wurde schon zu Beginn der indogermanischen Forschungen gestellt und hat inzwischen unzählige mehr oder weniger wohlbegründete Antworten erhalten. So ziemlich jedes Gebiet zwischen Atlantik, Nordmeer, Zentralasien und dem Indischen Subkontinent wurde schon vorgeschlagen. Neuerdings fand auch wieder die These von Anatolien als Urheimat Aufmerksamkeit in den Medien, die vor allem Colin Renfrew 1987 in seinem Buch „Archeology and Language“ („Archäologie und Sprache“) propagiert hatte, dessen Ideen allerdings bei den Fachleuten auf wenig Gegenliebe stießen.
Favorisiert wird heute eine Urheimat in einem Gebiet nördlich des Schwarzen und Kaspischen Meeres in der ukrainisch-russischen Steppe. Im 4. Jahrtausend v. Chr. – so die Theorie – machten sich einzelne Gruppen auf den Weg in die späteren Siedlungsgebiete; dadurch brach die bis dahin einheitliche Ursprache auseinander; es entstanden die Tochtersprachen, aus denen sich im Laufe der Jahrtausende die heutige indogermanische Sprachenvielfalt entwickelt hat. Obwohl bei dieser Theorie vieles gut zusammenpasst – Archäologie, Chronologie, Kultur und sprachlicher Befund – bleibt dennoch jede Antwort auf die Urheimatfrage letztlich eine Hypothese.
Dem unermüdlichen Forschergeist stellte sich bald aber eine sprachwissenschaftlich noch interessantere Frage. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts wollte man mehr über die Ursprache selbst wissen. Wie sahen ihre Laute aus? Wie könnten einzelne Wörter in der Ursprache geklungen haben? Wie wurden Substantive dekliniert und Verben konjugiert? Alles Fragen, die die Indogermanistik nach und nach immer genauer beantworten konnte. Der Schlüssel dazu war eine scheinbar primitive Methode: der Vergleich.
Hatte man schon durch den Vergleich von Wörtern und grammatischen Formen herausgefunden, welche Familienmitglieder zum Indogermanischen gehören und wie die Verwandtschaftsverhältnisse untereinander genauer aussehen, stellte sich die „komparative Methode“ auch als das geeignete Werkzeug für die Rekonstruktion der Ursprache heraus.
Wie funktioniert also die Rekonstruktion einer hypothetischen Ursprache, von der kein einziges Wort schriftlich überliefert ist?
Fangen wir mit den Einzellauten an. Oben wurde die Wortgleichung für „Vater“ mit lateinisch pater, gotisch fadar, griechisch patḗr und altindisch pitár angeführt. Der Anfangslaut ist in allen Sprachen ein p-, nur im Gotischen ein f-. Also macht es Sinn, für die Ursprache ein anlautendes *p- anzunehmen, einfach weil in der Mehrzahl der Tochtersprachen ein p- zu finden ist. [Nach einem Vorschlag von August Schleicher (1821–1868) werden rekonstruierte Laute und Wörter mit einem Sternchen * gekennzeichnet.] Der Endkonsonant ist in allen Wörtern ein -r, also rekonstruiert man dafür ein indogermanisches *r. Bei dem Konsonanten in der Wortmitte tanzt wieder das Gotische aus der Reihe. Während alle anderen Sprachen ein -t- haben, hat das Gotische ein -d-. Nach Mehrheitsentscheid rekonstuieren wir *t. Was hier beispielhaft und vereinfacht an der einen Wortgleichung vorgeführt wurde, hat man in mühseliger philologischer Kleinarbeit an Hunderten von anderen Wortkorrespondenzen nachvollzogen und bestätigt.
Hat man einmal die rekonstruierten Laute *p, *t oder *r gewonnen, kann man die Sache auch andersherum betrachten: Aus dem indogermanischen (kurz: idg.) *p- ist im Lateinischen, Griechischen und Sanskrit ein p- geworden (es gab also keine Veränderung), im Germanischen (Gotisch ist die älteste gut belegte germanische Sprache) aber ein f- wie z.B. in fadar. Damit sind wir bei der germanischen Lautverschiebung, die Jacob Grimm in seiner 1819 erschienenen „Deutschen Grammatik“ beschrieben hat. Man kann dieses Lautgesetz kurz als *p > f beschreiben: aus dem idg. *p wurde ein germanisches f. Weitere Korrespondenzen sind uns aus der Schule bekannt, nämlich *b > p oder *d > t, um nur einige zu nennen. Genau diese von Grimm erkannte Lautverschiebung kennzeichnet die germanischen Sprachen als eine Untereinheit des Indogermanischen.
Betrachten wir nun die Entwicklung des *p in anderen Tochtersprachen. „Vater“ heißt in der ältesten gut belegten keltischen Sprache, dem Altiririschen, athair, offensichtlich ist das anlautende idg. *p gänzlich entfallen; das ist in der Tat ein Charakteristikum der keltischen Sprachen. Im Armenischen heißt „Vater“ hayr, das anlautende *p hat sich zu einem armenischen h- entwickelt. Auf Grundlage solcher Erkenntnisse lassen sich für die einzelnen Tochtersprachen des Urindogermanischen regelmäßige Lautgesetze aufstellen, die beschreiben, wie sich die Laute der Ursprache in den Tochtersprachen weiterentwickelt haben.
Als weiteres Beispiel betrachten wir die Wortgleichung für das Wort „Herz“: lateinisch cord- (gesprochen kord-), gotisch haírtō (damit nah verwandt natürlich deutsch Herz), griechisch kardía, hethitisch kēr, litauisch širdìs (š wird wie deutsches sch ausgesprochen), armenisch sirt und altiranisch zərəd (z ist ein stimmhaftes s, ə ist ein Murmelvokal, der wie das e im deutschen Wort Glaube klingt). Wir vergleichen nur den anlautenden Konsonanten. Offensichtlich zerfallen die Tochtersprachen in zwei etwa gleichstarke Gruppen: Die einen haben am Wortanfang einen k-Laut (dazu gehört auch das Gotische, da das h- wie deutsches ch- auszusprechen ist), die andere Gruppe hat einen s-Laut. Welcher idg. Konsonant ist hier zu rekonstruieren, wo das Mehrheitsprinzip nicht mehr funktioniert? Man einigte sich auf ein k mit einem kurzen j-Nachschlag, also *kj oder *kj. Dieser Ansatz war keineswegs willkürlich. Man konnte in zahlreichen Sprachen der Welt feststellen, dass im Laufe der Sprachentwicklung kj entweder zu einem k-Laut oder aber zu einem s-Laut wurde. Übrigens hat man die indogermanischen Sprachen nach diesem Kriterium in Kentum- und Satem-Sprachen eingeteilt: Das Wort für „hundert“ heißt im Lateinischen centum (gesprochen kentum) und im Altiranischen satəm.
Ein besonderer Geniestreich der Indogermanisten war aber die „Erfindung“ indogermanischer Laute, von denen in den Tochtersprachen – mit Ausnahme des Hethitischen – keine direkte Entsprechungen erhalten geblieben sind. Diese sog. Laryngale (Kehlkopflaute) wurden postuliert, um gewisse Erscheinungen bei den Vokalen der Tochtersprachen erklären zu können. Der Streit über die „Laryngaltheorie“ tobte lange, heute ist die Existenz dieser Laute in der Ursprache allgemein anerkannt.
Der logisch nächste Schritt – in der historischen Entwicklung sind diese Schritte nicht zu trennen – ist die Rekonstruktion ganzer Wörter. So hat man aus den oben teilweise angeführten Wortgleichungen z.B. die idg. Wörter *pətḗr „Vater“, *dhughətḗr „Tochter“, *kjerd „Herz“ oder *ped „Fuß“ rekonstruiert. Schließlich entstanden ganze Wörterbücher, die die rekonstruierten idg. Wurzeln und ihre Abkömmlinge in den Tochtersprachen zusammenfassen.

Franz Bopp (1791–1867) gilt als Begründer der historisch-vergleichenden indogermanischen Sprachwissenschaft. (Bildquelle: Wikipedia, gemeinfrei)
Gewissermaßen die Krönung des Ganzen war die Rekonstruktion der Deklination und Konjugation in der Ursprache. Schon der deutsche Sprachwissenschaftler Franz Bopp hatte mit seinem 1816 publizierten Werk „Über das Conjugationssystem der Sanskritsprache“ auf die besondere Bedeutung der Formenlehre beim Sprachvergleich hingewiesen. Damit wurde er zum eigentlichen Stammvater der Indogermanistik. Betrachten wir wieder ein Beispiel. Die deutsche Form „(er/sie/es) ist“ vom Verbum „sein“ heißt im Gotischen ist, im Lateinischen est, im Griechischen estí und im Sanskrit ásti. Wenn man erkannt hat, dass das anlautende a- im Sanskrit sekundär entstanden ist, kommt man relativ zwanglos auf die Rekonstruktion der idg. Form *ésti. Ähnlich kann man die ganze Konjugation von „sein“ rekonstruieren und erhält z.B. für „(sie) sind“ idg. *sénti. Das Besondere am Verb „sein“ ist die Unregelmäßigkeit seiner Konjugation; diese Unregelmäßigkeiten finden sich ähnlich in allen Tochtersprachen wieder, ein unumstößlicher Beweis für die genetische Verwandtschaft der indogermanischen Sprachen und die Existenz einer Ursprache, aus der alle Tochtersprachen hervorgegangen sind.
Im Laufe von fast 200 Forschungsjahren ist es gelungen, die Laute, den Wortschatz und auch die Formenlehre der Ursprache weitgehend zu rekonstruieren. 1868 wagte es August Schleicher sogar, eine ganze Fabel „Das Schaf und die Pferde“ auf urindogermanisch zu formulieren, ein Versuch, der die seriösen Grenzen der Indogermanistik sprengt. Man kann ihn in der Wikipedia unter dem Stichwort „Indogermanische Fabel“ nachlesen. Der Prozess der Rekonstruktion der Ursprache ist übrigens keineswegs abgeschlosssen, wie ständig neugewonnene Erkenntnisse beweisen.
Der Autor ist Professor für Mathematik und Theoretische Informatik an der Technischen Universität Mittelhessen, Sprachwissenschaftler sowie Mitglied des VDS.
Beitrag aus VDS-Sprachnachrichten Nr. 57, März 2013