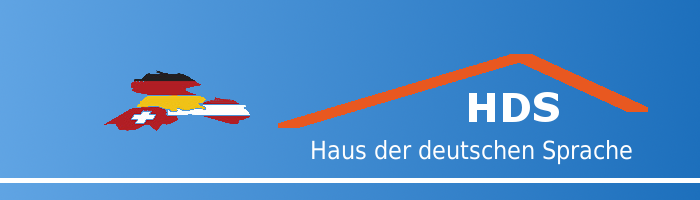Tschüßfreie Zone
von Birgit Schönberger

Die Sprache, die wir von Kindesbeinen an lernen, ankert deshalb so tief in unserem Bewusstsein, weil Empfindungen wie Lust, Angst, Freude, Trauer, Wut oder Zuneigung mit dem Erlernen untrennbar verbunden sind. Diese Muttersprache ist ein Teil unserer Persönlichkeit geworden.
Für über 60 Prozent der Deutschen ist dies eine regionale Form der deutschen Sprache, die sich erheblich von der Standardsprache unterscheiden kann. In der Südhälfte Deutschlands und im Saarland sind es gebietsweise über 90 Prozent, die den Dialekt als ihre Muttersprache angeben.
 Satzmelodie, Wortwahl und die ganz eigene Aussprache gehören zu unseren unverwechselbaren sprachlichen Kennzeichen. So schätzen wir schon um des eigenen Selbstwertgefühls die Muttersprache – ob Dialekt oder Hochsprache – als die höchste. Sie ist nicht nur Ausdruck unseres Selbst, sie ist darüber hinaus auch das starke Band zur Gruppe derer, die unsere Sprache sprechen. Jene, die anders sprechen, werden deswegen oft ausgegrenzt. Ja, manchem regional Einheimischen bereitet es eine diebische Freude, die eigene Mundart als “Geheimsprache“ zu verwenden, die den Zugereisten das Verstehen unmöglich machen soll.
Satzmelodie, Wortwahl und die ganz eigene Aussprache gehören zu unseren unverwechselbaren sprachlichen Kennzeichen. So schätzen wir schon um des eigenen Selbstwertgefühls die Muttersprache – ob Dialekt oder Hochsprache – als die höchste. Sie ist nicht nur Ausdruck unseres Selbst, sie ist darüber hinaus auch das starke Band zur Gruppe derer, die unsere Sprache sprechen. Jene, die anders sprechen, werden deswegen oft ausgegrenzt. Ja, manchem regional Einheimischen bereitet es eine diebische Freude, die eigene Mundart als “Geheimsprache“ zu verwenden, die den Zugereisten das Verstehen unmöglich machen soll.
Es gibt noch einen weiteren Grund für Sticheleien, ja Feindseligkeiten unter Sprechern verschiedener Muttersprachen: Existenzangst. Ist die Sprache der anderen mächtiger, durchsetzungsfähiger oder sitzen deren Vertreter an Schaltstellen des öffentlichen Lebens, dann sehen wir die Lebendigkeit unserer eigenen Sprache gefährdet, vielleicht bangen wir sogar um ihr Überleben. Wer glaubt, mit dem Rücken zur Wand zu stehen, entwickelt Hass und Häme gegenüber dem Ungewohnten, dem Fremden, fürchtet um die Grundlage seiner Ausdruckskraft, ja um seine Persönlichkeit selbst.
Nicht umsonst sprechen wir von der einigenden Kraft der gemeinsamen Sprache. Wir brauchen diesen “Kitt“, der Menschen mit oder ohne Dialekt und solchen, die hier leben, ohne Deutsch als Muttersprache gelernt zu haben, ein reibungsarmes Miteinander möglich macht. Ein Großteil der Erstklässler erwirbt Hochdeutsch heute beinahe wie eine erste Fremdsprache, denn zu Hause herrscht Dialekt vor. Im Ruhrgebiet aufgewachsen, erinnere ich mich, dass zu meiner Schulzeit Deutsch- und Musiklehrer an der sprachlichen Färbung ihrer Zöglinge feilten. Die Botschaft, die Hochsprache stehe über dem Dialekt, wurde zwar nicht wörtlich ausgesprochen, doch zwischen den Zeilen vermittelt. Dass diese Botschaft höchst zweifelhaft ist, zeigt die erneute Förderung der Dialekte seit den 1980er Jahren.
Daneben ist aber Hochdeutsch für viele die Muttersprache. Auch die sind in ihrer Sprache zu Hause, auch sie binden starke Gefühle an diese Form der deutschen Sprache. Einmischungen anderer Sprachen empfinden diese Menschen oft als störend und unschön; wenn sie überhand nehmen, als bedrohlich.
Nach meinen Erfahrungen – vorwiegend in Bayern – sehen Dialektsprecher diese Gefahr nicht. Ihr Hauptfeind in Sachen Sprachverdrängung ist Hochdeutsch. Gebetsmühlenartig werden die gleichen Vorwürfe, die alle klassischen Merkmale von Vorurteilen aufweisen, wiederholt: Hochdeutsch sei eine Kunstsprache ohne Leben; in der Hochsprache lasse sich nicht ausdrücken, was im Dialekt möglich ist; Dialektsprecher seien intelligenter, da sie beim Erlernen der Hochsprache eine größere geistige Leistung erbringen müssen; es gebe Ausdrücke und Wörter in der Hochsprache, bei deren Benutzung sich dem Dialektsprecher der Magen umdrehe. Wer die Schriftsprache verwende, spreche zu schnell, zu laut, zu viel, zu kantig und sei obendrein unhöflich.
Erklärt beispielsweise ein Bayer sein Wohnzimmer zu einer „tschüsfreien Zone“, nützen keine Erläuterungen. Meine Großmutter sagte noch „a tschüs“, das sich auf „à Dieu“ (adieu), also „Gott befohlen“ zurückführen lässt. Damit entspricht es inhaltlich „pfia God“, und es gäbe keinen Grund für einen Bayern, bei jedem „tschüs“ schmerzlich das Gesicht zu verziehen, als gelte es, eine Kröte zu schlucken.
Ist es notwendig, dass wir uns weiterhin auf beiden Seiten das Leben schwermachen, statt aufeinander zuzugehen? In Wahrheit gibt es doch, ob von ihren Sprechern anerkannt oder nicht, eine Symbiose zwischen Hochsprache und Dialekt. Sie brauchen einander. So wie Dialekte der Humus sind, auf dem Phantasie und Lebendigkeit gedeihen, die eine Sprachgruppe zusammenhalten, so ist die Hochsprache zum einen die Klammer für alle, darüber hinaus aber ein verlässliches, allgemeingültiges Kulturgut. Dabei ist das eine nicht mehr wert als das andere; nebeneinander können wir mit diesem Pfund wuchern.
Das wichtigste Argument für beide Lager, an einem Strang zu ziehen, ist der Einfluss von außen. Der Englischwahn in Deutschland verschont mittlerweile keinen Bildungszweig mehr und ist in Industrie und Wirtschaft zu einem Knebel für Berufstätige geworden. Unternehmer, die ihre Mitarbeiter nötigen, ihre Ideen in einer ihnen fremden Sprache darzulegen, machen aus gestandenen Fachleuten stammelnde Kleinkinder. Das ist nicht nur unwürdig, sondern auch geschäftsschädigend.
Wir sitzen alle im selben Boot, ob Dialektsprecher oder Vertreter der Hochsprache. Daher sollten wir endlich gemeinsam das Ruder ergreifen, statt um den Posten des Steuermanns zu streiten! Übrigens handelt es sich – für alle, die es noch nicht bemerkt haben sollten – um ein Rettungsboot!
Dieser Text erschien zuerst in den Sprachnachrichten (44/2009). Wir danken der Autorin und der Zeitschrift für die Genehmigung, ihn in das HDS zu übernehmen.