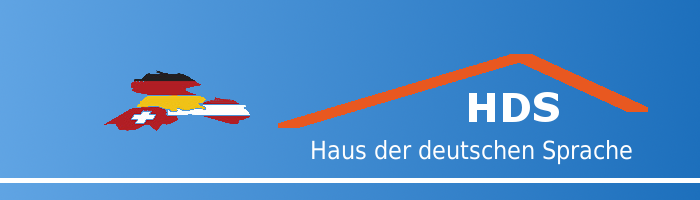Gedicht des Monats Februar 2011
((SCHLITTEN))
| Der erste Schnee Ei, du liebe, liebe Zeit, ei, wie hat´s geschneit, geschneit! Rings herum, wie ich mich dreh´, nichts als Schnee und lauter Schnee. Wald und Wiesen, Hof und Hecken, alles steckt in weißen Decken.Und im Garten jeder Baum, jedes Bäumchen voller Flaum! Auf dem Sims, dem Blumenbrett liegt er wie ein Federbett. Auf den Dächern um und um nichts als Baumwoll´ rings herum. |
Und der Schlot vom Nachbarhaus, wie possierlich sieht er aus: Hat ein weißes Müllerkäppchen, hat ein weißes Müllerjöppchen! Meint man nicht, wenn er so raucht, daß er just sein Pfeifchen schmaucht?Und im Hof der Pumpenstock hat gar einen Zottelrock und die ellenlange Nase geht schier vor bis an die Straße. Und gar draußen vor dem Haus! Wär´ nur erst die Schule aus! |
||
Aber dann, wenn´s noch so stürmt,
wird ein Schneemann aufgetürmt,
dick und rund und rund und dick,
steht er da im Augenblick.
Auf dem Kopf als Hut ´nen Tiegel
und im Arm den langen Prügel
und die Füße tief im Schnee
und wir rings herum, juhe!
Ei, ihr lieben, lieben Leut´,
was ist heut´ das eine Freud´!

Friedrich Güll (1812-1879), mittelfränkisch-bayerischer Lehrer und Verfasser vieler Gedichte für Kinder (“Das Büblein auf dem Eise“), lässt die Kleinen über den frischen Schnee jauchzen und über den verwandelten Anblick der gewohnten Umgebung belustigt staunen. In den zahlreichen deutschsprachigen Gedichten über das winterliche Weiß geht es um den ersten Schnee des Jahres, um seine überraschende Wirkung auf Auge und Gemüt.
Oder gar nur um die allerersten Flocken. Theodor Fontane (1819-1898) spielt – da wird er nicht mehr ganz jung gewesen sein – mit ihrer Farbe:
DER ERSTE SCHNEE
Herbstsonnenschein. Des Winters Näh‘
Verrät ein Flockenpaar;
Es gleicht das erste Flöckchen Schnee
Dem ersten weißen Haar.
Noch wird – wie wohl von lieber Hand
Der erste Schnee dem Haupt –
So auch der erste Schnee dem Land
Vom Sonnenstrahl geraubt.
Doch habet acht! mit einem Mal
Ist Haupt und Erde weiß,
Und Liebeshand und Sonnenstrahl
Sich nicht zu helfen weiß.
Auch Klabund (1890-1928, mit bürgerlichem Namen: Alfred Henschke) freut sich an der auf- hellenden Wirkung:
DER ERSTE SCHNEE
Der weiße Schnee beflügelt mein Gehirn.
Die Tannen auch erscheinen schön besternt.
So seien nun die Sonnen und die dürr’n
Oktoberzweige aus dem Blick entfernt.
Wenn dieses Glück uns auch nicht wärmer macht,
Und wenn vielleicht der Nebel trunken trieft,
Wir haben – selig! – eine weiße Nacht.
O denkt, wie lang ihr nicht im Hellen schlieft …
Einen Spaß besonderer Art bereitet sich und uns Günther von Goeckingk (1748-1828), indem er in die Sprache und das Gemüt eines jungen Mädchens schlüpft:
Gleich einem König, der in seine Staaten
Zurück als Sieger kehrt, empfängt ein Jubel dich!
Der Knabe balgt um deine Flocken sich
Wie bei der Krönung um Dukaten.
Selbst mir, obschon ein Mädchen und der Rute
Lang nicht mehr untertan, bist du ein lieber Gast;
Denn siehst du nicht, seit du die Erde hast
So weich belegt, wie ich mich spute?
Zu fahren ohne Segel, ohne Räder,
Auf einer Muschel hin durch deinen weißen Flor,
So sanft und doch so leicht, so schnell wie vor
Dem Westwind eine Flaumenfeder.
Aus allen Fenstern und aus allen Türen
Sieht mir der bleiche Neid aus hohlen Augen nach;
Selbst die Matrone wird ein leises Ach!
Und einen Wunsch um mich verlieren.
Denn der, um den wir Mädchen oft uns stritten,
Wird hinter mir, so schlank wie eine Tanne, stehn
Und sonst auf nichts mit seinen Augen sehn
Als auf das Mädchen mit dem Schlitten.
Dass Schnee nichts weiter als Wasser in einem seiner Aggregatzustände ist, dürfte schon seit Jahrtausenden bekannt sein. So ist es wohl einfach als Scherz gemeint, wenn der schlesische Barockdichter Friedrich von Logau (1605-55) seinen Lesern ein Rätsel aufgibt:
Wir sind mit Wasser gantz bedeckt; das Land hat keine Spur;
Wie daß denn auf dem Wasser noch zu Wagen mancher fuhr?
Eher bedrohlich empfindet der Schweizer Dichter (und Fontanes Jahrgangsgenosse) Gottfried Keller (1819-1890) den heranstürmenden Schnee. Er mahnt, sich durch innere Wärme zu wappnen:
IM SCHNEE
Wie naht das finster türmende
Gewölk so schwarz und schwer!
Wie jagt der Wind, der stürmende,
Das Schneegestöber her!
Verschwunden ist die blühende
Und grüne Weltgestalt;
Es eilt der Fuss, der fliehende,
Im Schneefeld nass und kalt.
Wohl dem, der nun zufrieden ist
Und innerlich sich kennt!
Dem warm ein Herz beschieden ist,
Das heimlich loht und brennt!
Wo, traulich sich dran schmiegend, es
Die wache Seele schürt,
Ein perlend, nie versiegendes
Gedankenbrauwerk rührt!
Nebeneinander Bilder von verschneitem Auto, Lokomotive (b. oben etwas und rechts gleich neben dem „o“ abscheiden) und Fahrrad – alles Dateien
Man braucht nicht Rad-, Auto-, Bahn- oder Flugreisender zu sein, um die weniger erfreulichen Seiten des Schnees zu erfahren. Auch unseren noch naturnäheren Vorfahren war er oft eine negativ besetzte Erscheinung. Der Holsteiner Johann Meyer (1829-1904) hat sowohl auf Plattdeutsch gedichtet als auch hochdeutsch, wie z.B. hier:
Schnee! nichts als Schnee!
Und der Hunger tut so weh!
Streut Krumen, Krumen
Auf die Erde nieder,
Daß nicht fehlen die Lieder,
Wenn da kommen die Blumen.
ROTER BALKEN
EU-Sprachen-„Salat“ Vokabelliste in Datei.
21 verschiedene Vokabeln haben die 23 EU-Amtssprachen für SCHNEE. Nur das Finnische und das Estnische teilen sich eine (LUMI) sowie das Italienische und Portugiesische (NEVE). Im türkisch-sprachigen Norden des EU-Mitglieds Zypern heißt das Weiß KAR.
GRAPHIK
BLAUER BALKEN
Für Friedrich Hebbel (1813-63), wie Meyer aus Holstein stammend und heute in erster Linie als Autor schicksalmächtiger Dramen bekannt, ist der Schnee ein Bild des Todes:
Unendlich dehnt sie sich, die weiße Fläche,
bis auf den letzten Hauch von Leben leer;
die muntern Pulse stocken längst, die Bäche,
es regt sich selbst der kalte Wind nicht mehr.
Der Rabe dort, im Berg von Schnee und Eise,
erstarrt und hungrig, gräbt sich tief hinab,
und gräbt er nicht heraus den Bissen Speise,
so gräbt er, glaub‘ ich, sich hinein ins Grab.
Die Sonne, einmal noch durch Wolken blitzend,
wirft einen letzten Blick aufs öde Land,
doch, gähnend auf dem Thron des Lebens sitzend,
trotzt ihr der Tod im weißen Festgewand.
GELBER BALKEN
Ohne sich für oder gegen den Schnee auszusprechen, malt Joachim Ringelnatz (1883-1934) eine
STILLE WINTERSTRASSE
Es heben sich vernebelt braun
Die Berge aus dem klaren Weiß,
Und aus dem Weiß ragt braun ein Zaun,
Steht eine Stange wie ein Steiß.
Ein Rabe fliegt, so schwarz und scharf,
Wie ihn kein Maler malen darf,
Wenn er’s nicht etwa kann.
Ich stapse einsam durch den Schnee.
Vielleicht steht links im Busch ein Reh
Und denkt: Dort geht ein Mann.
Nebeneinander Bilder
Georg Bötticher Ringelnatz
Eng darunter und klein: Bild: Ringelnatz-Verein
Bötticher Vater auf gleicher Höhe Bötticher Sohn
Da Ringelnatz mit bürgerlichem Namen Hans Gustav Bötticher hieß und der Sohn des ebenfalls (überwiegend für Kinder und junge Leute) dichtenden Georg Bötticher (1849-1918) war, stellen wir auch den mit einem Schnee-Gedicht vor. Kann man andere als heitere Gedichte in der sächsischen Mundart verfassen? (Von Nichtsachsen am besten laut zu lesen. Dann erschließt sich die Bedeutung mancher, nicht jeder, verwunderlichen Vokabel.)
ÄNNE LEIPZJER DENKMÄLER-STUDIE
Gomisch, wie d’r Schnee de Dinge ändert
Un mit allen seine Späße macht!
Neilich bin ich dorch de Stadt geschlendert,
Frieh, nachdems geschneit de ganze Nacht:
Da stand Dhär – Se genn sei Monnemende?
Mit ä weißen “Stermer“ auf’n Gobb,
In zwei weißen Baußhandschuhn de Hände –
Ganz wie ä Student, där alde Gnobb!
Leibniz, där, in Hof von Augusteum,
Sonst ä Buch hält – wie ä jeder weeß –
Hatte änne Scherze jetzt von Schnee um
Un in Arm ä Deller mit “Bäsees“!
Luther, ’ne Serviette vorne driewer,
Saß, ’s Gesicht mit Seefenschaum beschmiert,
Un Melanchthon bog sich iewern niewer –
Grade wie wenn eener een balwiert!
Vor d’n “Ferschtenhof“, die kleene Schmale,
Die de sonst nie was zu nibbeln kriegt,
Hielt ä Schlagsahnberg in ihrer Schale
Un schien driewer golossal vergniegt!
Hahnemann – der gauerte im Hemde! –
Weeß d’r Herr, de Deischung war frabbant!
Da verzog ich mich: es gamen Fremde
Und da is een so was doch schenant!