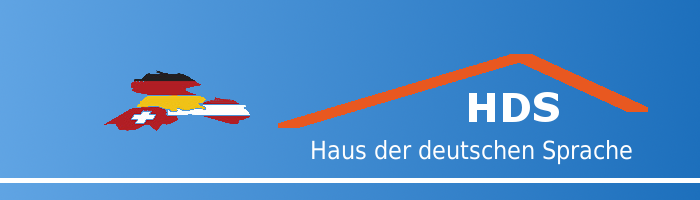Gedicht des Monats August 2010
DIE FÜSSE IM FEUER
Wild zuckt der Blitz. In fahlem Lichte steht ein Turm.
Der Donner rollt. Ein Reiter kämpft mit seinem Ross,
Springt ab und pocht ans Tor und lärmt. Sein Mantel saust
Im Wind. Er hält den scheuen Fuchs am Zügel fest.
Ein schmales Gitterfenster schimmert goldenhell
Und knarrend öffnet jetzt das Tor ein Edelmann …„Ich bin ein Knecht des Königs, als Kurier geschickt
Nach Nîmes *). Herbergt mich! Ihr kennt des Königs Rock!“ **)
„Es stürmt. Mein Gast bist du. Dein Kleid, was kümmert’s mich?
Tritt ein und wärme dich! Ich sorge für dein Tier!“
Der Reiter tritt in einen dunkeln Ahnensaal,
Von eines weiten Herdes Feuer schwach erhellt,
Und je nach seines Flackerns launenhaftem Licht
Droht hier ein Hugenott im Harnisch ***), dort ein Weib,
Ein stolzes Edelweib aus braunem Ahnenbild …
Der Reiter wirft sich in den Sessel vor dem Herd
Und starrt in den lebend’gen Brand. Er brütet, gafft …
Leis sträubt sich ihm das Haar. Er kennt den Herd, den Saal.
Die Flamme zischt. Zwei Füße zucken in der Glut.Den Abendtisch bestellt die greise Schaffnerin ****)
Mit Linnen blendend weiß. Das Edelmägdlein hilft.
Ein Knabe trug den Krug mit Wein. Der Kinder Blick
Hangt schreckensstarr am Gast und hangt am Herd entsetzt …
Die Flamme zischt. Zwei Füsse zucken in der Glut.
„Verdammt! Dasselbe Wappen! Dieser selbe Saal!
Drei Jahre sind’s … Auf einer Hugenottenjagd …
Ein fein, halsstarrig Weib … `Wo steckt der Junker? Sprich!‘
Sie schweigt. `Bekenn!‘ Sie schweigt. `Gib ihn heraus!‘ Sie schweigt.
Ich werde wild. Der Stolz! Ich zerre das Geschöpf …
Die nackten Füße pack ich ihr und strecke sie
Tief mitten in die Glut … `Gib ihn heraus!‘ … Sie schweigt …
Sie windet sich … Sahst du das Wappen nicht am Tor?
Wer hieß dich hier zu Gaste gehen, dummer Narr?
Hat er nur einen Tropfen Bluts, erwürgt er dich.“ –
Eintritt der Edelmann. „Du träumst! Zu Tische, Gast …“Da sitzen sie. Die drei in ihrer schwarzen Tracht
Und er. Doch keins der Kinder spricht das Tischgebet;
Ihn starren sie mit aufgerissnen Augen an –
Den Becher füllt und übergießt er, stürzt den Trunk,
Springt auf: „Herr, gebet jetzt mir meine Lagerstatt!
Müd bin ich wie ein Hund!“ Ein Diener leuchtet ihm,
Doch auf der Schwelle wirft er einen Blick zurück
Und sieht den Knaben flüstern in des Vaters Ohr …
Dem Diener folgt er taumelnd in das Turmgemach.Fest riegelt er die Tür. Er prüft Pistol und Schwert.
Gell pfeift der Sturm. Die Diele bebt. Die Decke stöhnt.
Die Treppe kracht … Dröhnt hier ein Tritt? Schleicht dort ein Schritt? …
Ihn täuscht das Ohr. Vorüberwandelt Mitternacht.
Auf seinen Lidern lastet Blei, und schlummernd sinkt
Er auf das Lager. Draußen plätschert Regenflut.
Er träumt. „Gesteh!“ Sie schweigt. „Gib ihn heraus!“
Sie schweigt. Er zerrt das Weib. Zwei Füße zucken in der Glut.
Aufsprüht und zischt ein Feuermeer, das ihn verschlingt …„Erwach! Du solltest längst von hinnen sein! Es tagt!“
Durch die Tapetentür in das Gemach gelangt,
Vor seinem Lager steht des Schlosses Herr – ergraut,
Dem gestern dunkelbraun sich noch gekraust das Haar.Sie reiten durch den Wald. Kein Lüftchen regt sich heut.
Zersplittert liegen Äste-Trümmer quer im Pfad.
Die frühsten Vöglein zwitschern, halb im Traume noch.
Friedsel’ge Wolken schwimmen durch die klare Luft,
Als kehrten Engel heim von einer nächt’gen Wacht.
Die dunkeln Schollen atmen kräft’gen Erdgeruch,
Die Ebne öffnet sich. Im Felde geht ein Pflug,
Der Reiter lauert aus den Augenwinkeln: „Herr,
Ihr seid ein kluger Mann und voll Besonnenheit
Und wisst, dass ich dem größten König eigen bin.
Lebt wohl! Auf Nimmerwiedersehn!“ Der andre spricht:
„Du sagst’s! Dem größten König eigen! Heute ward
Sein Dienst mir schwer … Gemordet hast du teuflisch mir
Mein Weib! Und lebst … Mein ist die Rache, redet Gott.“
| *) Stadt im Süden Frankreichs **) Uniform ***) Ritterrüstung ****) Haushälterin |

Conrad Ferdinand Meyer (1825-98)
Mal ehrlich! Haben Sie bei dem drängenden, fast hämmernden Rhythmus der Ballade überhaupt gemerkt, dass diese Verse keine Reime haben?
Der in Zürich geborene Conrad Ferdinand Meyer hat uns viele souverän gereimte Gedichte hinterlassen, gar eine ganze, umfangreiche Erzählung in Reimen (“Huttens letzte Tage“). Er konnte das also. Ein überzeugendes kürzeres Beispiel (1882):
DER RÖMISCHE BRUNNEN
Auf steigt der Strahl und fallend gießt
Er voll der Marmorschale Rund,
Die, sich verschleiernd, überfließt
In einer zweiten Schale Grund;
Die zweite gibt, sie wird zu reich,
Der dritten wallend ihre Flut,
Und jede nimmt und gibt zugleich
Und strömt und ruht.
(Fühlte sich Rainer Maria Rilke 24 Jahre später bei seinem Gedicht “Römische Fontäne“ durch Meyer herausgefordert, es noch ein wenig eleganter fließen zu lassen? Siehe Gedicht des Monats Juli 2008)
Oder das
HOCHZEITSLIED
| Aus der Eltern Macht und Haus Tritt die zücht’ge Braut heraus An des Lebens Scheide – Geh und lieb und leide ! |
Frommer Augen helle Lust Überstrahlt an voller Brust Blitzendes Geschmeide – Geh und lieb und leide! |
||
| Freigesprochen, unterjocht, Wie der junge Busen pocht Im Gewand von Seide – Geh und lieb und leide! |
Merke dir’s, du blondes Haar: Schmerz und Lust Geschwisterpaar, Unzertrennlich beide – Geh und lieb und leide! |
Einige der schönsten reimlosen Verse Meyers finden sich beim Gedicht des Monats Juni 2010. Meyer konnte seinen Gedichten eben auch ohne dieses Stilmittel eine festgefügte, wohlklingende Form geben – zum Beispiel bei dieser Augenwanderung in seinen geliebten Schweizer Bergen, von “feindselig“ zu “gastlich“:
DIE FELSWAND
Feindselig, wildzerrissen steigt die Felswand
Das Auge schrickt zurück. Dann irrt es unstät
Daran herum. Bang sucht es, wo es hafte.
Dort ! Über einem Abgrund schwebt ein Brücklein
Wie Spinnweb. Höher um die scharfe Kante
Sind Stapfen eingehaun, ein Wegesbruchstück!
Fast oben ragt ein Tor mit blauer Füllung:
Dort klimmt ein Wanderer zu Licht und Höhe!
Das Aug verbindet Stiege, Stapfen, Stufen.
Es sucht. Es hat den ganzen Pfad gefunden,
Und gastlich, siehe, wird die steile Felswand.
Zurück zum Monatsgedicht! Meyer hat es im Jahre 1882 veröffentlicht. Erkannten seine damaligen Leser sofort den historischen Hintergrund? Jedenfalls muss Meyer das geglaubt haben, denn ohne Umschweif lässt er das schaurig-dramatische, zunächst gänzlich rätselhafte Geschehen beginnen.
Dessen geschichtlicher Platz ist die sogenannte Hugenottenverfolgung zur Zeit des französischen Königs Ludwig XIV. (1638-1715; “l’ètat, c’est moi“). König Heinrich IV. (1553-1610) hatte 1598 mit dem sogenannten Toleranz-Edikt von Nantes die Verfolgung der französischen Protestanten (Hugenotten) untersagt. Dieses Edikt hob „der Sonnenkönig“ Ludwig 1685 wieder auf und setzte damit in Frankreich eine langjährige, gnadenlose Jagd auf die Andersgläubigen, d.h. die Nichtkatholiken, in Bewegung. Die Häscher des Königs waren unablässig im ganzen Lande unterwegs, um die Hugenotten aufzuspüren.
 |
 |
||
| Henri IV | Louis XIV |
Einer dieser Häscher ist der Reiter in dem Gedicht, einer der Gesuchten der Schlossherr, dessen standhafte Frau ihn beschützt und dafür mit ihrem Leben bezahlt hatte. – Die, je nach Loyalität, unterschiedliche Bedeutung von “größter König“ in den letzten fünf Versen lässt die historische Situation (siehe oben) kurz, aber zugespitzt aufblitzen: der weltliche “Sonnenkönig“ und Gott. Aber Meyer bietet nicht Geschichtsunterricht in Gedichtform, sondern ihn, und damit seine Leser, fesselt eine konkrete menschliche Konfliktsituation. Der Dichter steigert die Spannung von Vers zu Vers, weckt Ahnungen. Doch anders als im Kriminalroman fragt sich der Leser nicht: “Wer war’s?“. Das weiß er ja bald. Sondern: “Was hat der verbrochen?“ Was hat der Knabe dem Vater zugeflüstert? Die Antwort gibt uns der Schuldige selbst in seinen Gedanken oder seinem Selbstgespräch.
Ebenso bekannt wie durch seine Gedichte, vielleicht noch bekannter, wurde Meyer durch seine Prosa-Erzählungen. Einige von ihnen sind komplett im Internet nachzulesen, zum Beispiel die humorvolle Novelle Der Schuss von der Kanzel oder Gustav Adolfs Page und Das Amulett.
Das HDS wünscht viel Freude bei der Lektüre.