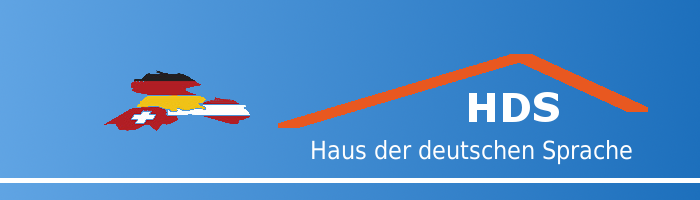Gedicht des Monats Mai 2011
|
|
| Ich habe genug. Lust, Flammen und Küße Sind giftig und süße Und machen nicht klug. Komm, seelige Freyheit, und dämpfe den Brand, Der meinem Gemüthe die Weißheit entwand.Was hab ich gethan! Jezt seh ich die Triebe Der thörichten Liebe Vernünftiger an; Ich breche die Feßel, ich löse mein Herz Und haße mit Vorsaz den zärtlichen Schmerz. |
Was quält mich vor Reu? Was stört mir vor Kummer Den nächtlichen Schlummer? Die Zeit ist vorbey. O köstliches Kleinod, o theurer Verlust! O hätt ich die Falschheit nur eher gewust!Geh, Schönheit, und fleuch! Die artigsten Blicke Sind schmerzliche Stricke; Ich mercke den Streich. Es lodern die Briefe, der Ring bricht entzwey Und zeigt meiner Schönen: Nun leb ich recht frey. |
Nun leb ich recht frey
Und schwöre von Herzen,
Daß Küßen und Scherzen
Ein Narrenspiel sey;
Denn wer sich verliebet, der ist wohl nicht klug.
Geh, falsche Syrene; ich habe genug!
Dies ist die Rechtschreibung der Entstehungszeit.
Im Folgenden zitieren wir in der heute gebräuchlichen.
Wer bemüht sich hier, verzweifelt, wütend, selbstkritisch, die “Krankheit“ namens Liebe loszuwerden? Johann Christian Günther hat das sein Leben lang versucht.
| Er ist 1695 im schlesischen Striegau (seit 1945: Strzegom) geboren und, im Alter von 28 Jahren, 1723 in Jena gestorben. Er hatte also nur kurze Zeit, hatte zu wenig Zeit, einen sicheren Platz im Leben zu finden. Sein strenger Vater, ein armer Kleinstadt-Arzt, bestand darauf, dass Johann Christian ebenfalls Medizin studiere. Da der jedoch schon in früher Jugend, als Gymnasiast im niederschlesischen Schweidnitz, das Dichten als seine wirkliche Berufung entdeckt hatte, betrieb er dieses Studium (in Wittenberg) lustlos und gab sich, nach allem, was wir wissen, eher den lockeren Formen des Studentenlebens hin – Tändeleien, Wein und stets: lieber dichten als studieren. Schon nach eineinhalb Jahren (1717) zog es ihn weiter nach Leipzig, also in eine der damaligen kulturellen und akademischen Metropolen des deutschsprachigen Raums. Vergeblich suchte er hier nach Sponsoren für seine Kunst – die nun, durch gelegentliche Auftragsgedichte, seine einzige Einnahmequelle war. Salopp ausgedrückt: der typische “Bettelstudent“ und disziplinlose Schöngeist. Einerseits. |  (Vermutlich einziges) zeitgenössisches Porträt (Vermutlich einziges) zeitgenössisches Porträt |
Andererseits war seine Beschäftigung mit der Dichtung – mit der eigenen und mit der anderer – durchaus fleißig und vorwärtsdrängend. Als er 1719 aus Sachsen nach Schlesien zurückkehrte, hatte er sich in drei Bereichen weiterentwickelt: In Leipzig war er mit wichtigen Vertretern der frühen Aufklärung in Berührung gekommen, des Rationalismus also und des weltlichen Individualismus. Er hatte die griechische und lateinische Lyrik gründlich studiert, und schließlich hatte er begonnen, seine Art zu dichten behutsam von den thematischen und sprachlichen Traditionen des 17. Jahrhunderts zu lösen.
Das hatte nichts mit Rebellion oder Selbstüberschätzung zu tun. Günther blieb der barocken Dichtung in vielem verbunden, entwickelte aber ihre Themen und Formen weiter. Vor allem aber schrieb er für andere Leser als seine dichterischen Vorgänger, für – vielleicht verfrüht – eine Art Bildungsbürgertum, also nicht mehr überwiegend für den höfischen Adel oder die Geistlichkeit. Die französische Revolution sollte zwar erst ein Jahrhundert später alles verändern. Doch der Geist des Rationalismus begann schon damals behutsam auch in die deutschen Länder hineinzuwehen und traf sich mit Günthers persönlicher Grundeinstellung. Der berühmte Satz des französischen Philosophen René Descartes (1596-1650) “Ich denke, also bin ich“ (Cogito, ergo sum) war Günther natürlich bekannt und eine Ermutigung.
Das mag sein folgenreichster Beitrag zur weiteren Entwicklung der deutschen Dichtung, zum Epochenwechsel vom Barock zur Vorklassik sein: Er sagt “ich“, er bringt sein “Ich“ in Stellung zu Gott:
BUSSGEDANKEN
Ich höre, großer Gott, den Donner deiner Stimme;
Du hörest auch nicht mehr. Ich soll von deinem Grimme
Aus Größe meiner Schuld ein ewig Opfer sein,
Ich soll, ich muss, ich will und gebe mich darein.
Ich trotze deinen Zorn, ich fleh nicht mehr um Gnade,
Ich will nicht, dass dein Herz mich dieser Straf entlade.
Du bist kein Vater mehr, als Richter bitt’ ich dich:
Vergiss vorher dein Kind, hernach verstoße mich.
Das ist keine Leugnung Gottes, kein lässiges “Gott ist tot“, das ist eine kämpferische Auseinandersetzung mit ihm (ich – du). Derartiges hätten Günthers barocke Vorgänger, z. B. Opitz, Dach, Fleming oder Gryphius, nicht über die Lippen, schon gar nicht zu Papier gebracht.
An seinem Vater, dem irdischen, leiblichen, hing er bis zum Ende. Doch der hatte ihn wegen seines unbürgerlichen Lebens, seiner brotlosen Poeterei früh verstoßen, entzog sich jeder Begegnung mit ihm. Auch ihm tritt Günther mit seinem “Ich“ gegenüber, flehend, rechtend und selbstgewiss. Tragisch mutet an, dass er den, der ihn wegen seines Dichtertums nicht mehr als Sohn haben wollte, ausgerechnet mit einem Gedicht umstimmen will. Die ersten und die letzten Verse dieses langen und ergreifenden Plädoyers in Reimen:
Und wie lange soll ich noch, dich, mein Vater, selbst zu sprechen,
Mit vergeblichem Bemühn Hoffnung, Glück und Kräfte schwächen?
Macht mein Schmerz dein Blut nicht rege, o so rühre dich dies Blatt,
Das nunmehr die letzte Stärke kindlicher Empfindung hat.
Fünfmal hab ich schon versucht, nur dein Antlitz zu gewinnen,
Fünfmal hast du mich verschmäht, o was sind denn dies vor Sinnen!
Denke nach, wie scharf es beiße, denke doch, wie nah es geh,
Dass ein Sohn durch seinen Vater zwischen Furcht und Unruh steh.
Hab ich dich nicht überall treu gerühmt und froh gepriesen?
Hat sich ein verstockter Sinn gegen deine Zucht gewiesen?
Hab ich nicht mit Lust studieret, dich nur einmal zu erfreun
Und mit wohlgeratnen Früchten deines Kummers Trost zu sein?
Such ich auf der Erden mehr als ein still- und weises Leben?[… nach weiteren vierhundert Versen zum Schluss:]
Lass den demutsvollen Kuss die Versöhnung wiederbringen;
Denn darauf, ich weiß gewiss, wird mir alles wohlgelingen.
Ich verspreche dir die Freude, die der Eltern Kreuz versüßt,
Wenn das Wachstum guter Kinder ihres Nachruhms Spiegel ist.
Deinen Segen, dein Gebet schätz ich über große Güter;
Dieser Beifall, dieser Ruhm, den die ehrlichsten Gemüter
Deiner Frömmigkeit erteilen, ist ein Vorzug, der dich ehrt
Und auch mir als deinem Sohne durch das Erbgangsrecht gehört.
Es ist niemals mein Gebrauch, große Dinge zu begehren
Noch des Himmels mildes Ohr mit viel Wünschen zu beschweren,
Weiß doch dieser selbst am besten, was die Notdurft haben will:
Gibt er mir dein Herz bald wieder, schweig ich gern zu allem still.
Auch zu Leonore spricht sein “Ich“, zu der Frau, die er lang, mit Unterbrechung und wohl von Beginn an irrtümlich als die seine empfunden und geliebt hat. Ihre Erwiderung dichtet er selber gleich mit:
| AN LEONORENIch nehm’ in Brust und Armen Den schweren Abschiedskuss. Der Himmel hat Erbarmen, Indem er trennen muss. Ich küss’ und wein und liebe, Mein treues Lorchen spricht, Sie habe gleiche Triebe; Wie aber, weint sie nicht? |
LEONORENS ANTWORT:Du suchest ja dein Glücke, Das hier wohl nicht mehr blüht, Ich hasse das Geschicke, Das uns vonsammen zieht. Ach, sähst du meine Schmerzen – Ich schweige, wertes Licht; Ich liebe dich von Herzen, Und darum wein’ ich nicht. |
Vor allem aber, sein “Ich“ steht in der Welt, in der diesseitigen, steht in seinem “Jetzt“, steht seinen Zeitgenossen gegenüber, stünde aber gern anderswo:
ALS ER SICH ÜBER DEN EIGENSINN DER HEUTIGEN WELT BEKLAGTE
| Man muss doch mit den Wölfen heulen, Drum fort, betörter Eigensinn! Ich will mich in die Leute teilen Und lachen, wie und wo ich bin. Ein Sauertopf mag immer schelten Und unsre Zeit dem Satan weihn, Denn untersucht er tausend Welten, Wird keine sonder Mangel sein.Das ist wohl wahr: Es gibt viel Toren. Das macht, sie wachsen ungesät, Und wer nicht schiert, der wird geschoren, Sobald er nur den Rücken dreht. Aus Komplimenten und Flattieren Erkennt man den Politikum, Will einer nun nicht Hunde führen, So kehr er stets den Mantel um. Bei Höfen sinnt man nur auf Mittel, |
In Städten steht es nicht viel besser, Da herrschen Schwelgerei und Neid, Man schneidet mit dem großen Messer Dem Nächsten in sein Ehrenkleid; Wer uns von vorne grüßt und lecket, Der spuckt uns über Achseln nach, Und wer sich nach der Decke strecket, Den schimpft ein jegliches Gelach.Die Weiber sind gar ausgelassen, Sie tun es frei beim Mondenschein, So hitzig, dass auf allen Gassen Die Pflaster ausgeritten sein. Die Männer folgen dem Exempel, Kaum riecht was Junges in die Stadt, So läuft man plötzlich aus dem Tempel, Zu sehn, wie viel es Keuschheit hat. Was soll ich von den Mägden sagen? |
|
|
||
Klagen über den Zustand der Welt kennen wir aus gewaltigen Gedichten des Hochbarocks. Sie hatten, historisch bedingt, meistens die Grauen des Dreißigjährigen Krieges (1618-48) zum Gegenstand, wie die Eingangsstrophen der Epochen-Elegie (1643) eines anderen großen Schlesiers, Andreas Gryphius (1616-64):
 |
|
||
| Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr denn ganz verheeret! Der frechen Völker Schar, die rasende Posaun, Das vom Blut fette Schwert, die donnernde Kartaun Hat aller Schweiß und Fleiß und Vorrat aufgezehret. Die Türme stehn in Glut, die Kirch‘ ist umgekehret. |
Für Günther waren die Gedichte seiner Vorgänger noch immer Zeugnis dieses Grauens. Doch der schreckliche Krieg lag nun mehr als ein halbes Jahrhundert zurück. Günther leidet am aktuellen Zustand der ihn umgebenden Gesellschaft. Der betrifft ihn in unmittelbarer, in persönlicher Form. Als einen seiner Feinde, vielleicht den eigentlichen, erkennt er sich selbst:
ALS ER SICH ÜBER SEINEN UNGLÜCKSELIGEN ZUSTAND BEKLAGTE
| Alles eilt zum Untergange, Nur mein hart Verhängnüs nicht. Harter Himmel, ach wie lange Zeigst du sein erschröcklich Licht? Soll er mir jetzund erscheinen, O so gib ihm bald sein Amt, Eh mich ein verzweiflend Weinen Noch zu größrer Not verdammt.Ich, ein Mensch von schlechtem Zeuge, Kann mir selbst nicht widerstehn, Dass ich kaum gelassen schweige, Wenn die Wellen höher gehen. Fleisch und Blut behält im Schmerzen Über die Vernunft das Feld, Und die Hoffnung steckt im Herzen, Welches keinen Mensch erhält. |
Hätt ich Bosheit im Gemüte Oder an den Lastern Lust, So verzieh ich mich der Güte Deiner treuen Vaterbrust. Aber ach, so wirst du finden, Prüfe Mienen, Herz und Sinn, Dass ich bei den Schwachheitssünden Doch nicht sonder Buße bin.Zwar sind, die noch ärger leben Und mit Lastern Schaden tun, Die lässt du im Glücke schweben Uns in deinem Schoße ruhn. Sie verschwenden deinen Segen Nur zu Trotz auf meinen Fall, Handeln, wie die Toren pflegen, Doch gerät es überall. |
||
|
|||
Lag es an dieser vehement kritischen Haltung zu seiner Umwelt, seinem Zeitalter und zu sich selbst, dass seine unmittelbaren Zeitgenossen keinen Geschmack an seiner Dichtung finden konnten, dass sie ihn schlicht ignorierten und er keine Verleger fand, jedenfalls erst 1724, im Jahr nach seinem Tode? Das war genau einhundert Jahre nach dem Erscheinen von Martin Opitz’ “Buch von der deutschen Poeterey“ (1624), das die entscheidenden Regeln für eine zeitgemäße deutsche Dichtungssprache aufgestellt hatte, und fünfzig Jahre vor Goethes “Leiden des jungen Werthers“ (1774) – den gefühlvollen Briefen in der “ich“-Form an ein “du“ Als die erste Sammlung von Günthers Gedichten dann doch endlich erschienen war, fand sein schmales, kraftvolles Werk schnell ein größeres Publikum. Weitere Auflagen folgten in kurzem Abstand,
Das sprachliche Genie Günthers war nun erkannt. Was später als “Sturm und Drang“, etwa des jungen Goethe, zur Signatur der Vorklassik werden sollte, war noch nicht einmal am Horizont erkennbar. Doch Günthers energie- und ich-starke Sprachmacht war ein Bahnbrecher.
In hohem Alter (“Dichtung und Wahrheit“ (II, 7 [1812]) erinnert Goethe an Günther: “Betrachtet man genau, was der deutschen Poesie fehlte, so war es ein Gehalt, und zwar ein nationeller; an Talenten war niemals Man gel. Hier gedenken wir nur Günthers, der ein Poet im vollen Sinne des Worts genannt werden darf. Ein entschiedenes Talent, begabt mit Sinnlichkeit, Einbildungskraft, Gedächtnis, Gabe des Fassens und Vergegenwärtigens, fruchtbar im höchsten Grade, rhythmisch bequem, geistreich, witzig und dabei vielfach unterrichtet; genug, er besaß alles, was dazu gehört, im Leben ein zweites Leben durch Poesie hervorzubringen, und zwar in dem gemeinen wirklichen Leben […] Das Rohe und Wilde daran gehört seiner Zeit, seiner Lebensweise und besonders seinem Charakter, oder, wenn man will, seiner Charakterlosigkeit. Er wußte sich nicht zu zähmen, und so zerrann ihm sein Leben wie sein Dichten.“
gel. Hier gedenken wir nur Günthers, der ein Poet im vollen Sinne des Worts genannt werden darf. Ein entschiedenes Talent, begabt mit Sinnlichkeit, Einbildungskraft, Gedächtnis, Gabe des Fassens und Vergegenwärtigens, fruchtbar im höchsten Grade, rhythmisch bequem, geistreich, witzig und dabei vielfach unterrichtet; genug, er besaß alles, was dazu gehört, im Leben ein zweites Leben durch Poesie hervorzubringen, und zwar in dem gemeinen wirklichen Leben […] Das Rohe und Wilde daran gehört seiner Zeit, seiner Lebensweise und besonders seinem Charakter, oder, wenn man will, seiner Charakterlosigkeit. Er wußte sich nicht zu zähmen, und so zerrann ihm sein Leben wie sein Dichten.“
AN GOTT UM HÜLFE
|

Günthers (und unser aller) “ich“ hat in den 23 Amtssprachen der Europäischen Union diese 21 verschiedenen Entsprechungen. Nur Dänisch und Norwegisch (“jeg“) sowie Portugiesisch und Rumänisch (“eu“) teilen sich je eine Vokabel. Im türkischsprachigen Norden des EU-Mitgliedstaats Zypern heißt dieses Fürwort “ben“.